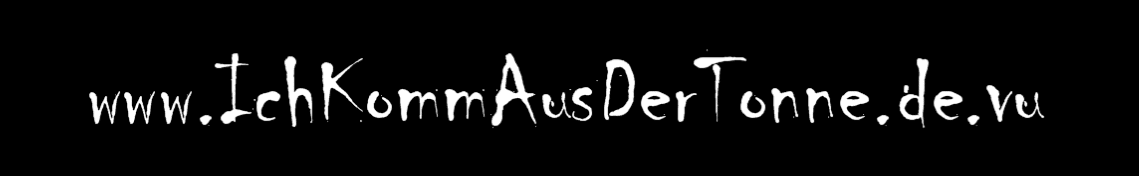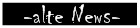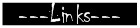Erklärung Demokratie www.DieTonne.de
Demokratie
[griechisch, "Volksherrschaft"]
Staatsform, in der die Staatsgewalt vom Volk ausgeht ("getragen" wird) und direkt oder indirekt von ihm ausgeübt wird. - Die Demokratie entwickelte sich in Europa zuerst in den griechischen Stadtstaaten als direkte oder unmittelbare Demokratie. Sie wurde von Aristoteles unter dem Namen Politie zu den drei grundlegenden "guten" Staatsformen gerechnet, wohingegen er als Demokratie die Entartung der Politik bezeichnete. Doch war die griechische Demokratie, ebenso wie die römische, wirtschaftlich und soziologisch auf der Sklaverei aufgebaut und kann insofern nicht mit der modernen Entwicklung der Demokratie verglichen werden.
Die moderne Demokratie erwuchs zunächst aus den calvinistischen Glaubenskämpfen des 17. Jahrhunderts, besonders in Schottland, England und den Niederlanden, in denen die Gemeinde als Träger des religiösen und politischen Lebens hervortrat, sodann aus den Lehren der Aufklärung, besonders aus ihren Anschauungen von der Freiheit und Gleichheit aller und von der normativen Bedeutung des vernünftigen Denkens des Einzelnen über Staat und Gesellschaft. Grundlegend wurden die Lehren J. J. Rousseaus von der Volkssouveränität als einem unteilbaren und unveräußerlichen Recht des Volkes. Das Volk wird hier als Gemeinwesen aufgefasst, dessen Wille sich entweder als Mehrheitswille (französisch volonté de tous) oder als Gesamtwille (französisch volonté générale) äußert, der nur auf das allgemein Beste gerichtet ist und deshalb indirekt auch die Absichten abweichender Gruppen umfasst, die er folglich ebenfalls verpflichtet. Dieser Wille ist der "Souverän" und oberste Gesetzgeber im Staat. Aus dieser Lehre folgt der allgemeine demokratische Grundsatz der Herrschaft der Mehrheit, deren Wille in der Regel mit dem Gesamtwillen übereinstimmt. Allerdings gibt es nach Rousseau auch Fälle, in denen der Mehrheitswille irregeleitet und der wahre Volkswille (Gesamtwille) von der Minderheit repräsentiert wird, die dann das Recht hat, die Mehrheit, notfalls mit Gewalt, auf den richtigen Weg zu leiten ("man muss die Menschen zwingen, frei zu sein"). Demnach lassen sich aus der Lehre Rousseaus die verschiedensten Ausgestaltungen demokratischer Staaten bis zur modernen "Volksdemokratie" und zur sozialistischen Demokratie herleiten, die sich ebenfalls als Demokratien in dem oben beschriebenen Sinn verstehen, wobei aber als Volk in der sozialistischen Demokratie nur die Werktätigen angesehen werden.
Der erste moderne demokratische Staat waren die USA. In Europa wurde erstmals in der Französischen Revolution ein Staat auf demokratischen Prinzipien gegründet, und zwar wurden hier schon die beiden für die weitere Entwicklung der Gesamtordnung demokratischer Staaten wichtigen Phasen, die der liberal-rechtsstaatlichen (konstitutionellen und Gewalten teilenden) Demokratie (1789-1792) und die der diktatorischen und manchmal auch absolutistischen Demokratie (Jakobinerherrschaft 1792-1794) durchlaufen. - Ältere demokratische Verfassungselemente erhielten sich vor allem in der Schweiz.
Die Entwicklung der einzelnen europäischen Staaten zur Demokratie verlief sehr unterschiedlich. Während Großbritannien unabhängig von der Beibehaltung der Monarchie in der Staatsgestaltung des 19. Jahrhunderts (Ausprägung des Parlamentarismus, des Kabinettsystems, des Zweiparteiensystems) nahezu unmerklich eine demokratische Staatsform entwickelte, war dies in Frankreich nach einigen kurzen Versuchen (1848) erst mit der Entstehung der III. Republik der Fall (1871, Verfassungsgesetz von 1875); in Deutschland nach dem Scheitern der unter konstitutionellem Vorzeichen stehenden Versuche von 1848 im Kaiserreich erst mit der Verfassungsänderung vom 28. 10. 1918 (Einführung der parlamentarischen Verantwortung der Regierung, Ausdehnung des Gegenzeichnungsrechts nunmehr auf alle militärischen Akte des Kaisers) und vor allem mit der Errichtung der Weimarer Republik (Verfassung vom 11. 8. 1919). Die Republik von 1919 wies plebiszitäre Züge auf (das Volk wählte den Reichspräsidenten und konnte von ihm und aus sich - über ein Volksbegehren - durch den Volksentscheid zur unmittelbaren Gesetzgebung herangezogen werden). Die demokratische Staatsform stieß bei weiten Bevölkerungsteilen auf Ablehnung, die sich teils für eine Restauration der Monarchie, teils für eine kommunistische, teils für eine autoritär-faschistische Staatsgestaltung einsetzten. Der Nationalsozialismus hat nach seinem Sieg von 1933 auch kein Hehl aus seiner Abneigung gegenüber demokratischen Prinzipien gemacht und sie in jeder Hinsicht als "Degenerationserscheinung" hingestellt, sich aber gleichzeitig des Mittels der Volksabstimmungen bedient und so den Gleichklang zwischen Staatsführung und Volksmeinung darzutun versucht.
Nach 1945 wurde in Deutschland erneut der Versuch einer Verwirklichung der demokratischen Staatsform gemacht. Im Westen entstand in der Bundesrepublik Deutschland eine Demokratie westlicher Prägung im Sinne der Gewaltenteilung, der Rechtsstaatlichkeit und des Bundes- und Sozialstaats (Art. 20 und 28 des 1949 in Kraft getretenen Grundgesetzes). Die sowjetische Besatzungszone wurde 1949 in die österreichisch-sowjetischen Modellen Nachgeformte Deutsche Demokratische Republik umgewandelt. Zwar trug die ursprüngliche Verfassung auch hier noch deutliche Kennzeichen der liberalen Republik von Weimar, doch die Verfassungspraxis entfernte sich immer mehr hiervon. Die von Anfang an bestehende Alleinherrschaft der kommunistischen SED wurde 1968 in der Verfassung verankert. Tatsächlich traf das Politbüro der SED alle wesentlichen Entscheidungen in sämtlichen Lebensbereichen. Die formal vorhandenen demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen dienten nur der Verschleierung dieser Diktatur.
Im Übrigen zeigt die demokratische Staatsform auch innerhalb des Westens erhebliche Unterschiede: Zunächst gibt es die Scheidung in die plebiszitäre und die repräsentative Demokratie. Die plebiszitäre Demokratie zeichnet sich - wie die Weimarer Republik - durch die Möglichkeit unmittelbarer Volksentscheidungen aus, sei es durch die vom Volk vorzunehmende Wahl des höchsten Staatsorgans, sei es durch die Möglichkeit, auf dem Weg über ein Volksbegehren und anschließenden Volksentscheid oder nach Anordnung des Staatsorgans unmittelbar durch Volksentscheid das Volk zum Gesetzgeber zu machen. Doch auch bei dieser Konstruktion bleibt die normale Gesetzgebung dem Parlament vorbehalten. Es handelt sich also bei den plebiszitären Entscheidungen immer nur um seltene Ausnahmefälle. Sehr häufig sind sie allerdings in der Schweiz (Volksentscheid). - In einer repräsentativen Demokratie - die Bundesrepublik Deutschland gehört zu diesem Typus - ist jede plebiszitäre Entscheidung ausgeschlossen (nur Art. 29 GG [Neugliederung des Bundesgebietes] und Art. 118 [Südweststaat] gestatten Volksentscheide). Die heftigen Reaktionen bei der Frage der atomaren Ausrüstung der Bundeswehr zeigen deutlich den Rückzug der Bundesrepublik Deutschland auf ein betont repräsentatives System, während z. B. Frankreich unter de Gaulle aufgrund der Verfassung von 1958 und ihrer Änderungen die plebiszitäre Legitimierung der "autoritären Demokratie" auszubauen bestrebt war.
Eine weitere wichtige Unterscheidung ist diejenige zwischen der parlamentarischen und der nicht-parlamentarischen Demokratie. Unter Parlamentarismus ist dabei nicht das Vorhandensein und Funktionieren des Parlaments zu verstehen, sondern die Abhängigkeit der Regierung vom Vertrauen der Legislative. Die westlich-europäischen Gestaltungen sind dem englischen Vorbild entsprechend nachgeformt; auch die Bundesrepublik Deutschland kennt die Möglichkeit des Misstrauensvotums gegen den Bundeskanzler, wenn auch in der gegenüber Weimar modifizierten Form des sog. konstruktiven Misstrauensvotums (Sturz nur bei gleichzeitiger Einigung auf den Nachfolger). Selbst Frankreich hat dieses parlamentarische System unter der autoritären Regierung de Gaulle beibehalten. - Den Gegentypus bilden die Vereinigten Staaten. Dort ist der Präsident - der zudem noch die beiden Ämter des Staatsoberhaupts und des Regierungschefs in seiner Person vereinigt - keineswegs vom Vertrauen des Kongresses abhängig; Repräsentantenhaus und Senat können den Präsidenten nicht zum Rücktritt zwingen.
Die Verschiedenheit der nationalen Tradition und die Rücksichtnahme auf jeweils andere soziale Gegebenheiten sowie eine abweichende Beurteilung bestimmter Verhaltensweisen lassen die Demokratie als eine Aufgabe der Neuzeit erscheinen, für die es eine Vielfalt von Formen und Grundtypen gibt. Hinter der grundsätzlichen Festlegung, dass die Staatsgewalt beim Volk liegt (und nicht bei einer privilegierten Schicht, einer Klasse oder Gruppe), eröffnen sich zahlreiche Wege und Möglichkeiten für sehr unterschiedliche Gestaltungen. Deshalb wird die Demokratie zu jeder Zeit und für jedes Volk zu einer besonderen Aufgabe.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!